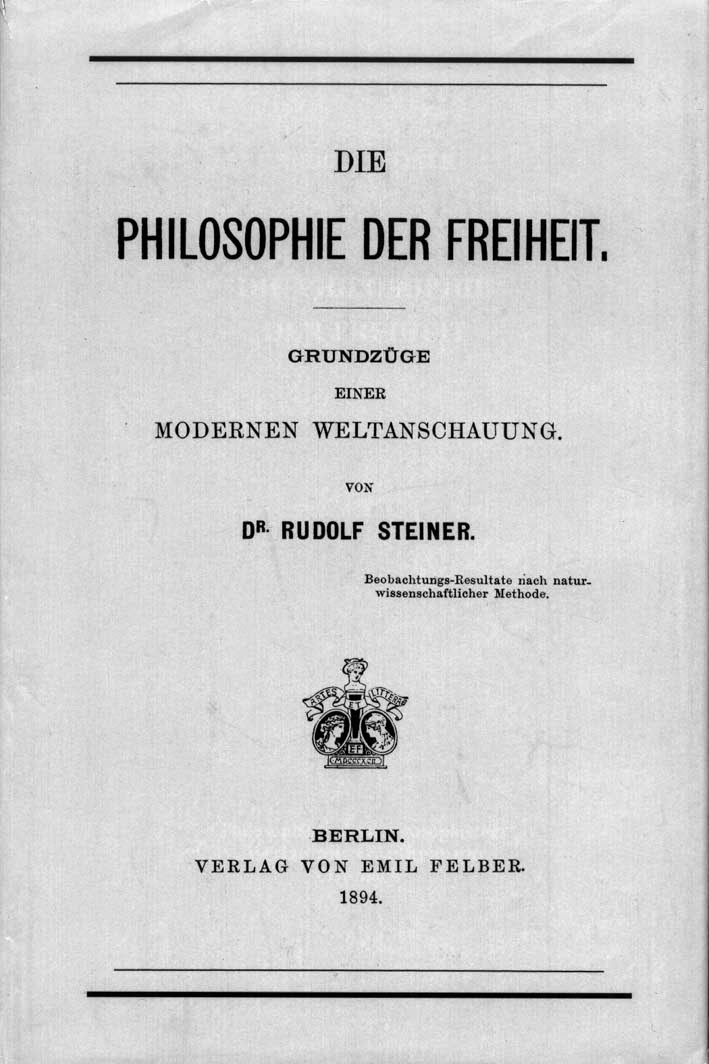Wie kann ein kritisches Denken sich den philosophischen Schriften Rudolf Steiners heute annähern? (Fragen zu SKA 2, Teil I)
Christian Clement
Nach Abschluss des 7. Bandes der SKA drehen sich meine Gedanken jetzt um einen angemessenen Zugang zu Steiners philosophischen Schriften. In diesem und folgenden Beiträgen möchte ich einige Fragen und Gedanken einbringen, die mich in diesem Zusammenhang beschäftigen. Alle "Egoisten" sind eingeladen, sich an diesem Gespräch so an der Entstehung der Einleitung zum kommenden Band zu beteiligen.
»Zwei Wurzelfragen sind es, nach denen hingeordnet ist alles, was durch dieses Buch besprochen werden soll.« Mit diesen Worten leitet Rudolf Steiner die im Jahre 1918 erschienene zweite Auflage seiner Philosophie der Freiheitein. Ein Herausgeber dieser Schrift, und überhaupt jeder, der mit den philosophischen Schriften Steiners kritisch umgeht, hat sich ebenfalls eine »Wurzelfrage« vorzulegen, die aus einer eingehenderen Beschäftigung mit diesen Texten unausweichlich hervorgeht. Diese lautet: Kann der junge Rudolf Steiner als »Philosoph« im gewöhnlichen Sinne dieses Wortes verstanden werden? Oder war er ein Mystiker, ein Esoteriker, der sich des Philosophischen nur für eine zeitlang als äußerer Form, als Medium bedient hat? -
Der Zweifel am philosophischen Charakter der in Frage stehenden Texte ist nicht eine von aussen an diese herangetragene; Steiner hat diese Frage durch vielfache während seines Lebens gemachte Äußerungen selbst aufgeworfen. Und er tat dies nicht erst als gereifter Esoteriker im Rückblick auf die Schriften seiner vortheosophischen Lebensphase, sondern schon zur Zeit von deren Abfassung. So heißt es in einem Brief Steiners an seine damalige Gesprächspartnerin Rosa Mayreder aus dem Jahr 1895, also knapp ein Jahr nach Veröffentlichung der Erstausgabe der Philosophie der Freiheit und ein gutes Jahrsiebt vor seinem Eintritt in die Theosophische Gesellschaft:
Ich lehre nicht; ich erzähle, was ich innerlich durchlebt habe. Ich erzähle es so, wie ich es gelebt habe. Es ist alles in meinem Buche persönlich gemeint. Auch die Form der Gedanken. Eine lehrhafte Natur könnte die Sache erweitern. Ich vielleicht auch zu seiner Zeit. Zunächst wollte ich die Biographie einer sich zur Freiheit emporringenden Seele zeigen. Man kann da nichts tun für jene, welche mit einem über Klippen und Abgründe wollen. Man muß selbst sehen, darüberzukommen. Stehenzubleiben und erst andern klar zu machen: wie sie am leichtesten darüberkommen, dazu brennt im Innern zu sehr die Sehnsucht nach dem Ziele. Ich glaube auch, ich wäre gestürzt: hätte ich versucht, die geeigneten Wege sogleich für andere zu suchen.
Die erste Frage, welche dem kritischen Leser dieser Texte entgegentritt ist also diese: handelt es sich hier, wie in den Titeln und Vorworten dieser Schriften versprochen wird, um systematische fachphilosophische Abhandlungen über das »Grundproblem der Erkenntnistheorie«, das Wesen von »Wahrheit und Wissenschaft« und über die Frage, ob sich der Mensch »als wollendes Wesen die Freiheit zuschreiben« darf? Oder haben wir vielmehr rein »subjektive Erzählungen« vor uns, Berichte von persönlichem inneren Erleben während der Beschäftigung mit philosophischen Fragen, eine innere »Biographie des sich zur Freiheit emporringenden« Rudolf Steiner?
Doch ist damit das Rätsel um die Einordnung der vorliegenden Schriften noch nicht zureichend beschrieben. Noch problematischer wird das Lesen dieser Texte dadurch, dass Steiner als gereifter Esoteriker, im biographischen Rückblick, wiederum ein ganz anderes Deutungsmodell vorstellte. Nun sollte sein Frühwerk (wobei Steiner sich explizit meist auf die Philosophie der Freiheit bezieht, implizit aber auch immer seine Dissertationsschrift von 1891 mit einbezieht) als Ausdruck einer Esoterik bzw. einer Mystik zu verstehen sein, die ihm bereits in den 80er und 90er Jahren als inneres Erlebnis vor Augen gestanden habe, für die er jedoch damals den adäquaten sprachlichen Ausdruck noch nicht habe finden können. Ja überhaupt, so der reife Steiner, könne ein wirklicher Esoteriker vor seinem 35 Lebensjahr nicht öffentlich auftreten.
Nach einem von J. W. Stein überlieferten Gespräch empfand Steiner schon während seiner philosophischen Phase ein deutliches Bewusstsein von seiner eigentlichen Mission als Esoteriker, empfand es aber zugleich als seine ihm vom Schicksal auferlegte Aufgabe, zunächst durch seine Auseinandersetzung mit Goethe und dann in seinen philosophischen Schriften dem wissenschaftlichen Denken seiner Zeit eine Alternative anzubieten. „Alles im Gewande der idealistischen Philosophie!“, so habe ihm sein geheimnisvoller »Meister« immer wieder eingeschärft.
Dabei sei jedoch dieses sein Eintreten für eine esoterisch-mystische Weltanschauung im Gewande der idealistischen Philosophie nicht eigentlich seine genuine Lebensaufgabe gewesen, sondern diejenige seines Lehrers und Mentors Karl Julius Schröer. Und nur weil dieser seiner ihm vom Schicksal zugedachten Aufgabe nicht gewachsen gewesen sei, habe er, Steiner, in seinem Frühwerk gewissermaßen das »Karma« Schröers auf sich genommen und die diesem zugewiesene Aufgabe erfüllt, bevor er sich einer eigentlichen Lebensaufgabe, der Ausbildung der Anthroposophie, zugewendet habe. Ja noch mehr: erst durch das mit dieser Tat verbundene persönliche Opfer habe er überhaupt erst praktisch-existentiell erfahren, was die menschliche Freiheit wirklich sei und sei erst so in die Lage versetzt worden, seine Freiheitsphilosophie zu schreiben:
Ich entschloß mich damals, Schröers Schicksal als mein eigenes zu leben unter Verzicht auf das Ausleben meines eigenen Schicksalsweges […] Indem ich diesen Entschluß damals faßte, erlebte ich das Wesen der Freiheit. Ich konnte meine Philosophie der Freiheit schreiben, weil ich erlebt hatte, was Freiheit ist.
Der reife Steiner mutet seinen Lesern somit zu, dasjenige, was er einerseits in Form von sachlich-fachbezogenen philosophischen Abhandlungen vorgelegt und dann als Darstellung seiner persönlichsten subjektiven Erkenntniserlebnisse charakterisiert hatte, nun auch noch als Botschaft eines von Anfang an mit übersinnlichen Erkenntnisfähigkeiten ausgestatteten und in tiefe esoterische Geheimnisse eingeweihten »Hellsehers« zu verstehen, der bewusst das beschränkte und beschränkende Medium philosophischer Darstellung wählte, um so die Schröersche Mission einer spirituellen Befruchtung des modernen wissenschaftlichen Denkens zu erfüllen. Sowohl deren philosophische Form wie auch ihr subjektiv-persönlicher Inhalt wären somit nur als eine Art »Maske« zu verstehen, welche der sein esoterisches Wissen noch zurückhaltende Mystiker solange aufsetzte, bis er nach Erreichen der erforderlichen Reife die Larve ablegen, offen als Esoteriker und spiritueller Lehrer vor die Welt treten und mit der Ausbildung der Anthroposophie seine eigentliche Lebensaufgabe angehen konnte.
Schon diese rückwirkende Umdeutung der eigenen Frühschriften durch den später zum Esoteriker gewordenen Steiner muss aus kritischer Sicht hochproblematisch erscheinen und ist dem Anthroposophiegründer von der Kritik denn auch immer wieder vorgeworfen worden. Sie wird dadurch kompliziert, dass daneben noch ein weiteres, ebenfalls durch Steiners retrospektive Selbstdeutung vermitteltes Deutungsschema vorliegt, welches mit dem vorigen in Konkurrenz tritt. Denn es gibt auch solche Äußerungen, in denen Steiner seine philosophischen Texte als Anleitungs- und Übungsbücher zum Erwerb des sinnlichkeitsfreien Denkens bezeichnet, also als Anweisung zur Ausbildung jener Formen höherer bzw. übersinnlicher Erkenntnis (Imagination, Inspiration und Intuition), aus welchen nach Ansicht des späten Steiner die anthroposophischen Erkenntnisse hervorgehen und deren systematische Ausbildung den Wissenschaftsanspruch der Anthroposophie untermauern soll. Steiners philosophische Schriften wären somit nicht als verhüllte Darstellungen übersinnlichen Wissens zu lesen, sondern als verhüllte Anleitungen zu deren Erwerb; also nicht "Frucht" sondern "Wurzel" seiner esoterischen Weltanschauung. Schon 1904 in der Theosophiesprach er von »zwei Wegen« zur Erlangung des in der Anthroposophie zum Ausdruck kommenden höheren Wissen und stellt den »Denkweg« der Philosophie der Freiheit neben den in seinen späteren Schriften vorgelegten »Meditationsweg«:
Wer noch auf einem anderen Wege [als auf dem der Meditation, C.C.] die hier dargestellten Wahrheiten suchen will, der findet einen solchen in meiner »Philosophie der Freiheit«. In verschiedener Art streben diese beiden Bücher nach dem gleichen Ziele. Zum Verständnis des einen ist das andere durchaus nicht notwendig, wenn auch für manchen gewiß förderlich.
Dann wiederum gibt es andere Passagen, wo Steiner die zwei Pfade der philosophischen Gedankenarbeit und der Meditation nicht mehr als gleichwertige Wege zum gleichen Ziel versteht, sondern den Meditationspfad und die Anthroposophie insgesamt als zeitbedingt und damit einer künftigen Entwicklung oder Überwindung unterworfen charakterisiert, während der "Pfad" der Philosophie der Freiheit allein den Ansturm der Zeit überstehen werde. Denn hier werde die Wurzel, die Quelle beschrieben, aus der die Anthroposophie entsprungen sei - und aus der somit (dies jedenfalls scheint impliziert) auch jede künftige Weiterentwicklung der Anthroposophie, jede weitere Entwicklungsstufe des menschlichen Bewusstseins werde entspringen müssen. In dem oben bereits zitierten Gesprächsbericht von Stein lesen wir:
Schon aus diesen knappen Andeutungen wird deutlich, mit welcher Fülle von Fragen, Ambivalenzen und Spannungen man es zu tun bekommt, wenn man sich den philosophischen Schriften Steiners zuwendet. Wie hat ein heutiger kritischer Leser, wie hat ein unparteiischer Herausgeber mit diesen divergierenden Aussagen und Ansprüchen umzugehen? Muss er sich, wie bisher in den meisten inneranthroposophischen Interpretationen geschehen, für eine von den genannten Lesarten entscheiden und von da aus versuchen, die Texte zu verstehen? Also den Philosophen gegen den Esoteriker ausspielen, oder umgekehrt? Oder die eine esoterische Deutung gegen die andere? - Oder gibt es eine Deutungsperspektive, aus der die verschiedenen Selbstcharakterisierungen Steiners allesamt ernst genommen werden können? Können diese Texte irgendwie sowohl als Beitrag zur Philosophiegeschichte wie auch als Spiegel der inneren Entwicklung Rudolf Steiners, und zugleich sowohl als Frucht wie auch als Wurzel der Steinerschen Esoterik verstanden werden? Und würde ein solcher Steiners multiple Selbstansprüche ernst nehmender Ansatz den Anforderungen kritischen Denkens und wissenschaftlichen Arbeitens genügen? - Oder muss der kritische Leser Steiners Aussagen als offenkundig widersprüchlich und unvereinbar ignorieren und (wie jüngst Helmut Zander und Hartmut Traub) einen anderen, den Texten und dem Denken Steiners äußerlichen Interpretationsmaßstab anlegen?Ich fragte Rudolf Steiner: Was wird nach Jahrtausenden von Ihrem Werk noch übrig bleiben? Er antwortete: Nichts als die Philosophie der Freiheit. Aber in ihr ist alles andere enthalten. Wenn jemand den dort geschilderten Freiheitsakt realisiert, findet er den ganzen Inhalt der Anthroposophie!