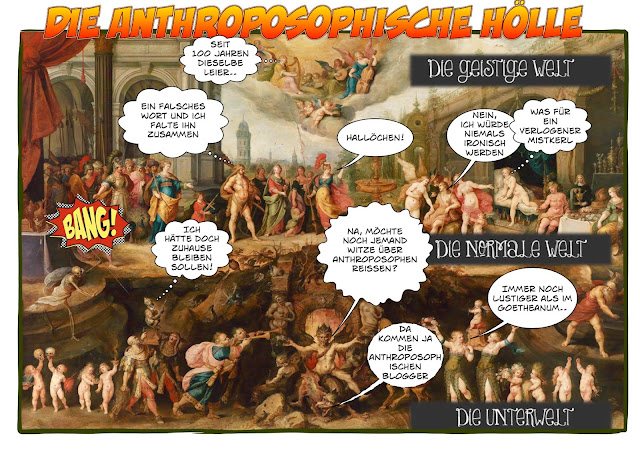Kritische Nachlese zum Erscheinen der Schriften »Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit« (1)
Zugleich ein Plädoyer wider die »anthroposophische Korrektheit«
(2009 bei den Egoisten erschienen)
In den letzten Jahren häufen sich die Stimmen derer, die eine Konvergenz anthroposophischer Inhalte mit »rassistischen« bzw. »antisemitischen« Anschauungen für ausgemacht halten. Während in dem ersten Band der vom Bund der Waldorfschulen herausgegebenen Reihe »Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit« die Verfasser (noch unter Mitwirkung des inzwischen verstorbenen Manfred Leist) den Antisemitismus-Verdacht zu entkräften suchen und den Nachweis führen, dass Steiners »ethischer Individualismus« den Hintergrund für dessen Zurückweisung judenfeindlicher Gesinnungen bildete, nehmen sich in einer zweiten, etwas umfangreicheren Studie Hans-Jürgen Bader und Lorenzo Ravagli des eher allgemein erhobenen Rassismus-Vorwurfes an.
Zur Widerlegung der Kolportage, der Begründer der Anthroposophie sei »Rassist« gewesen, können die Autoren vordergründig auf eine Fülle von Zitaten aus dem mündlichem und schriftlichen Werk Steiners zurückgreifen, deren Inhalte die Essenz seines Menschen- und Weltverständnisses unmittelbar berühren. Wenn Steiner prognostizierte, dass »
nichts mehr« als atavistische »
Rassen-, Volks- und Blutsideale« die moderne Menschheit in den »
Niedergang« führen würden, wenn er die Aufnahme des Christus-Impulses durch den freien Willen als ein Mittel zur Genesung der in Nationen, »
Rassen«, Religionen und Kulturen zersplitterten, einen Menschheitsfamilie anempfahl, wenn er nicht müde wurde, den völkerverbindenden und rassenübergreifenden Charakter der Anthroposophie herauszustreichen, dann sind dies nicht beiläufig oder operational geäußerte Lippenbekenntnisse, sondern dann handelt es sich hierbei um die Quintessenz einer Menschenkunde, die den Primat der Individualität gegenüber »Gattungsmerkmalen« wie »Rasse«, Ethnie oder Geschlecht betont. Man könnte solche Äußerungen auch als Bekenntnisse einer kosmopolitischen Weltanschauung deuten, die im »ethischen Individualismus«, der Möglichkeit gedanklicher Intuitionen, ihren Quellgrund hat.
Mit den beiden Studien sind somit vor allem durch die Medienberichterstattung verunsicherten Waldorfeltern und -lehrern bzw. jedem ernsthaft an der Anthroposophie Interessierten Materialien und Argumente an die Hand gegeben, die es ermöglichen, Gespräche mit Kritikern nicht länger nur aus einer Position der Defensive heraus zu bestreiten. Zumindest scheint es so auf den ersten Blick.
Je mehr man sich jedoch in die Lektüre dieser beiden Studien vertieft, desto mächtiger werden die Zweifel, ob der dezidiert apologetische Ton, welcher den Kommentaren der Autoren zu Äußerungen Steiners über »Rassen«, Ethnien und das Judentum unterlegt ist, nicht eher kontraproduktiv ist. Beim Leser könnten so ungewollt Idiosynkrasien freigesetzt und Abwehrressourcen mobilisiert werden, was weniger dem Inhalt als vielmehr dem Stil der Darstellung zuzuschreiben wäre. Schnell könnte infolgedessen der Eindruck entstehen, dass die Autoren letztlich doch voreingenommen und somit ideologisch argumentierten. Der Verdacht eines überwiegend apologetisch motivierten Rundumschlags bestätigt sich denn auch nach wenigen Seiten. Nahrung erhält er etwa dadurch, dass die Verfasser über einzelne, durchaus prekäre Implikationen des bewusstseinsevolutionären Geschichtsbildes Steiners großzügig hinweggehen, so als ob diese gar nicht existierten. Denn als rassistisch muss aus heutiger Sicht Steiners sporadisches Bemühen gewertet werden, biologische «
Rassen» mit dem Grad der mentalen «
Entwicklungsreife» ihrer Angehörigen zu korrelieren und so- mit eine Hierarchisierung von Menschengruppen spirituell zu begründen, deren unterste Sprossen den – aufgrund ihrer physischen «
Degeneration» zum Aussterben verurteilten – Indianern sowie den von «
Trieben» und «
Witterungen» dominierten «
Negern» vorbehalten bleiben.
Die Tatsache, dass Steiner bisweilen auch anerkennende Worte über den Animismus der Indianer, die «
Naturgeistigkeit» der Afrikaner oder die «
Tao-Religion» der Chinesen verlor, wie die Autoren Bader und Ravagli nicht müde werden zu betonen, markiert eine entscheidende Schwachstelle der sich geschichtsevolutionären Denkmustern verpflichtet fühlenden Anthroposophie: Folgt deren historisches Verständnis doch einer zutiefst eurozentrischen Binnenlogik, derzufolge außereuropäische Kulturen, selbst wenn sie über spirituelle Ressourcen beträchtlichen Umfangs verfügen, fast grundsätzlich «
atavistisch» seien und sogar noch unter der materialistisch geprägten Zivilisation des modernen Europa rangierten, die immerhin eine Vorbereitungs- und Durchgangsstufe zur Entwicklung der «
Bewusstseinsseele» darstelle. Die «
arische» oder europäische hielt Steiner, der hieraus allerdings keine imperialen oder kolonialistischen Zielsetzungen ableitete, denn auch für die «
zukünftige, da am Geiste schaffende Rasse». Sie repräsentiert innerhalb seines Weltanschauungskosmos die «
fünfte nachatlantische Kulturepoche», deren Anfang er auf den Beginn der frühen Neuzeit datierte. Die diskriminierenden Implikationen des evolutionsgeschichtlichen Stufenmodells hoffte Steiner durch eine Dialektik einzuholen, die er seinen gelegentlich auch rassenkundlichen Überlegungen vorschaltete: Die Reinkarnationsfolgen der menschlichen Individuen führten demnach durch die verschiedenen biologischen «
Rassen» hindurch, so dass, «
obgleich man uns entgegenhalten kann, dass der Europäer gegen die schwarze und die gelbe Rasse einen Vorsprung hat, doch keine eigentliche Benachteiligung» (2) bestehe. Natürlich könnte zur Entlastung Steiners ins Feld geführt werden, dass dieser an anderen Stellen seines voluminösen Vortragswerkes das hierarchische Modell der »
Rassen« und Kulturen wieder verwarf und diesem somit offensichtlich nur eine Teilberechtigung zugestand. Dies schließt jedoch das Bemühen um geschichtliche Kontextualisierung bzw. um Historisierung entsprechender Auffassungen nicht aus. Gerade unter anthroposophischen Interpreten sollte es überdies Usus sein, den Maßstab der kritischen Beurteilung an einen Denker, der den »Eingeweihten« zugehörte, höher anzulegen als bei durchschnittlich wahr- nehmenden und urteilenden Zeitgenossen. De facto geschieht jedoch meist das genaue Gegenteil.
Von Kant bist Steiner: Antijudaistische Geschichtsdeutungen idealistischer Philosophen und ihr Fortwirken in der Anthroposophie
Im Folgenden werden Beispiele angeführt, die zu einer kritischen Auseinandersetzung mit rassentheoretischen Äußerungen Rudolf Steiners herausfordern. In einem Fall werden auch Aussagen beleuchtet, die von Friedrich Rittelmeyer (1872-1938), dem protestantischen Theologen, Mitbegründer und ersten Erzoberlenker der anthroposophisch inspirierten Christengemeinschaft, stammen. Um Missverständnissen vorzubeugen: Es kann hierbei nicht um das »Verurteilen« von Menschen aus der sicheren Distanz der Nachgeborenen gehen, um die selbstgerechte Diskreditierung von Personen also, die überaus Bedeutsames auf ihrem Gebiet geleistet haben. Der moralisierende Jargon der »Political Correctness«, wie er heute viele Beiträge auszeichnet, liegt dem Verfasser dieses Aufsatzes fern.
Anthroposophen sollten sich jedoch – so die Kernthese des Beitrags – mit aus heutiger Sicht problematischen Traditionssträngen auseinandersetzen, die im Überlieferungshorizont des christlichen Abendlandes tief verwurzelt sind und deren Spuren sich auch in Werken Steiners und denen seiner Schüler aufweisen lassen. Gemeint ist vor allem die Tradition eines bereits unter christlichen Denkern der Aufklärung virulenten Antijudaismus, dessen Vertreter die jüdische Religion als historisch überholt abwerteten, ihre Existenzberechtigung aufgrund geschichtsphilosophischer Erwägungen negierten und somit folgerichtig die »
Euthanasie des Judentums« (3) (I. Kant) durch völlige Assimilation ihrer Angehörigen an die christliche Umgebungskultur einforderten.
Steiners peripheren Beschäftigungen mit dem zeitgenössischen Judentum bewegten sich im Spannungsfeld zwischen einem aufgeklärten, die Assimilation bedingungslos einfordernden Antijuduaismus und der christlichen Tradition soteriologisch untermauerter Judenfeindschaft, ohne dass dessen Anschauungen über jüdische Kultur und Religion bereits restlos in dieser ideengeschichtlichen Schnittmenge aufgingen. Seine Urteile über das Diasporajudentum, die zwischen einer spirituellen Wertschätzung jüdischer Kultur und Esoterik auf der einen und einer Deligitimation der »
jüdischen Denkweise« und des »
Judentums als solchem« auf der anderen Seite oszillierten, partizipierten an antijüdischen Stereotypen, Chiffren und Denkmustern, wie sie im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhunderts unter Angehörigen des europäischen Bildungsbürgertums vielfach verbreitet waren. (4) Es ist zudem gewiss kein Zufall, dass Steiner wesentliche Anstöße bezüglich der Genese seines philosophisch-anthroposophischen Werkes den Schriften Kants, Fichtes, Hegels und Herders verdankte, Denkern also, die stellvertretend für die Mehrheit der christlichen Aufklärer an der Überzeugung von der Obsoletheit des Judentums festhielten und ein evolutionshistorisches Stufenmodell favorisierten. (5)
Der Versuch idealistischer Geschichtsphilosophen, dem europäischen Judentum seine Existenz streitig zu machen und dessen Vorhandensein – wie Rudolf Steiner in einem Aufsatz von 1888 – als einen »
Fehler der Weltgeschichte« (6) zu inkriminieren, hat spätestens seit dem »
Zivilisationsbruch Auschwitz« (Dan Diner) seine ideengeschichtliche Unschuld verloren. Letzteres gilt auch für Rassentheorien, die der Begründer der Anthroposophie dem theosophischen bzw. dem gesellschafts- und fraktionsübergreifenden Diskurs damaliger Zeit entnahm und die er sukzessive seinen eigenen Einsichten und Forschungen im Über- sinnlichen anverwandelte. (7) Steiner gebrauchte die Vorstellungs- und Ausdrucksformen, die Bilder und »wissenschaftlichen« Fragestellungen seiner Zeit und Umgebung, um seine durch übersinnliche Forschung gewonnenen Erkenntnisse in ein Medium zu übersetzen, dessen Sprache von den damaligen Zuhörern und Lesern »verstanden« werden konnte. Heute wäre es freilich vonnöten, die Anthroposophie von jenen zeitbedingten Modi der Vermittlung zu lösen, durch die sie vor fast einhundert Jahren räumlich und zeitlich in Erscheinung getreten ist. Denn die Anthroposophie ist nicht einfach nur das Werk Rudolf Steiners, sondern das Werk Steiners legt Zeugnis ab von den unablässigen Bemühungen und Anstrengungen eines Menschen, Anthroposophie zu individualisieren und zugleich Ausdrucksformen zu schaffen, die es anderen ermöglichen, an den Ergebnissen dieser Individualisierungs- Bemühungen Anteil zu nehmen.
Da Steiner nicht immer eindeutig zwischen Übernahmen aus der zeitgenössischen Literatur und eigenständig Erforschtem differenzierte, seine Gedanken überdies oftmals zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungs- und Bewusstseinszuständen changierten, besteht für den heutigen Interpreten zudem eine erhebliche Herausforderung darin, dessen Werk mit den Mitteln der historisch-kritischen Forschung nach zeitbedingten Engführungen oder auch Irrtümern zu durchforsten. Neben Erkenntnissen »höherer« Art sind in das Werk Steiners nachweislich Elemente damaliger Bezugsquellen sowie situations- und zeitabhängige Urteile eingegangen, die nicht selten von heutigen Anthroposophen als «Anthroposophia perennis» unreflektiert weitertradiert werden.
Die quellenphilologische Analyse und Deutung kann freilich nur der erste Schritt eines verschiedene Grade der Bewusstheit durchlaufenden »Prüfens« von »geisteswissenschaftlichen« Mitteilungen sein. Zur Ebene des unbefangenen Verstandesdenkens, das nach Steiner die Grundlage der anthroposophischen Schulungswege bildet, können früher oder später andere Erkenntnisstufen und -fähigkeiten treten, die Steiner in seinem Buch »
Die Stufen der höheren Erkenntnis« (und in vielen anderen Schriften und Vorträgen) mit den Begriffen »
Imagination«, »
Inspiration« und »
Intuition« benennt. Das imaginative Bewusstsein vermag eines geistigen Inhalts auf bildhaft-vorstellungshafte Weise, das inspirative Bewusstsein in inspirativ-Zusammenhang stiftender Art und das intuitive Bewusstsein in Form eines individual- universalen Wesensaustauschs inne zu werden. Über die »
materielle Erkenntnisart« und ihr Verhältnis zu den genannten Ebenen höherer Erkenntnis führt der Verfasser aus: »
Bevor der Mensch den Pfad höherer Erkenntnis betritt, kennt er nur die erste von vier Erkenntnisstufen. Es ist diejenige, welche ihm im gewöhnlichen Leben innerhalb der Sinneswelt eigen ist. Auch in dem, was zunächst ›Wissenschaft‹ genannt wird, hat man es nur mit dieser ersten Erkenntnisstufe zu tun. Denn diese Wissenschaft arbeitet ... das gewöhnliche Erkennen feiner aus, macht es disziplinierter.« (8)
Die Ausführungen und Deutungen des vorliegenden Beitrags wenden sich vor allem an jenes Urteils- und Denkvermögen, welches der ersten Erkenntnisstufe des von Steiner beschriebenen vierstufigen Initiationsweges entspricht. Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass sich auf den Ebenen der Imagination, Inspiration und Intuition andere «Fragestellungen», «Antworten» oder «Evidenzen» ergeben als auf der Stufe der so genannten materiellen Erkenntnisart. Das von Steiner vielfach beschriebene «
intuitiv erlebte Denken» (9) bzw. die «
seelische Beobachtung» (10) bilden eine Art Bindeglied zwischen dem Bereich des «
unbefangenen Denkens» und den Stufen höherer Erkenntnis, auch wenn die Möglichkeiten zur Entwicklung letzterer bereits keimhaft in dem ersteren veranlagt sind. Wer allerdings die Möglichkeiten des an das Verstandesdenken geknüpften Forschens, Fragens und Deutens geringschätzt, diese nicht soweit wie möglich auszuschöpfen trachtet und stattdessen darauf hinarbeitet, möglichst schnell zu »höheren« Einsichten vorzustoßen, der gleicht einem Heilpraktiker, der die Anwendung schuldmedizinischer Wissensinhalte und Methoden mit der Begründung verschmäht, dass diese auf einer reduktionistischen Wahrnehmung des Menschen aufbauten. Welcher Patient aber würde sich von einem solchen Dilettanten den Blinddarm operieren lassen?
Anthroposophische Rassentheorie: Rudolf Steiner über das »Aussterben« der Indianer
Aus heutiger Sicht befremdlich erscheint das Maß schier grenzenlosen Vertrauens, das Rudolf Steiner der Auffassungs-, Urteils- und Differenzierungsgabe seiner aus unterschiedlichen sozialen Schichten und weltanschaulich-politischen Milieus stammenden Zuhörer- und Leserschaft entgegenbrachte. In seinen Vorträgen findet sich nur selten der warnende Hinweis, dass die von ihm so unbekümmert verwendeten Völker- und Rassentypologien zugleich ein gefahrvolles Ferment darstellen, in dem Vorurteile und Klischeevorstellungen einen idealen Nährboden vorfinden. In diesem Zusammenhang wäre es sicher interessant, einmal der Frage nachzugehen, welche Wirkungen negative Attributs- Zuschreibungen rassen- und völkertypologischer Art, wie Steiner sie als eine unter Anthroposophen weithin unangefochtene Autorität vornahm, im Bewusstsein der damaligen Leser und Zuhörer entfalteten. Eine kritische Bestandsaufnahme der Rezeptions- Geschichte anthroposophischer Rassenlehren steht bislang noch aus. Waren die damaligen Zuhörer und Leser »reif« genug, um vor der Gefahr einer rassistischen Instrumentalisierung derartiger Charakterisierungen gefeit zu sein?
Über eine solche Frage kann hier natürlich nicht pauschal entschieden werden. In den Vorträgen des 1910 in Kristiania (Oslo) gehaltenen »
Volksseelen-Zyklus« deutete der Referent immerhin mehrmals die Gefahr eines solchen Missverstehens an. Im weiteren Verlauf dieser kosmopolitisch und emanzipatorisch orientierten »
Volksseelenkunde« will es Steiner allerdings nicht so recht gelingen, die seinen völker- und rassentheoretischen Klassifikationen stets immanente Gefahr der Stereotypisierung und der rassistisch verkürzten Exegese vollständig zu bannen. Enthält der vom Redner nachträglich durchgesehene und autorisierte Text doch etwa jene Passage über die Ursachen des »
Aussterbens« der Indianer, welche aufgrund ihrer freischwebenden Vieldeutigkeit wohl schon damals von Theosophen so gelesen werden konnte, dass hier die Vernichtung der Einheimischen durch europäische Kolonisatoren als karmische Notwendigkeit gerechtfertigt werde: »
Nicht etwa deshalb, weil es den Europäern gefallen hat, ist die indianische Bevölkerung ausgestorben, sondern weil die indianische Bevölkerung die Kräfte erwerben musste, die zum Aussterben führten.« (11)
Zur Aufschlüsselung dieses Satzes, dessen Inhalt oft von Kritikern als Beleg für das »Menschenverachtende« des anthroposophischen Karmagedankens herangezogen wird, schreiben die Autoren Bader und Ravagli: »
Gemeint ist, dass in den Populationen, die Amerika bevölkerten, der Prozess der Rassenbildung insgesamt zum Stillstand gekommen ist, dass die Menschheit nach Westen gehen musste, ›um als Rasse zu sterben‹, d.h. um an das Ende der Abhängigkeit von physischen Differenzierungen zu gelangen. Die Leiblichkeit der so genannten indianischen Rasse repräsentiert innerhalb der gesamten Variationsbreite des menschlichen Organismus jene Form, die dem Geist, damit aber auch dem Tod am nächsten steht, denn der Geist ist die Verneinung des Stoffs, so wie das Alter die Verneinung der jugendlichen Lebensfülle ist. Die nord-, mittel- und südamerikanischen Indianer wurden zwar von den europäischen Kolonisatoren ausgerottet, ein Vorgang, den Steiner an anderen Stellen auch beim Namen nennt und verurteilt.« (12)
Tatsache bleibt jedoch, dass Steiner in diesem grundlegenden Vortragszyklus den Genozid an der autochthonen Bevölkerung Amerikas nicht beim Namen nennt, sondern im Gegenteil den Eindruck erweckt, als sei der millionenfache Mord an den Bewohnern der Neuen Welt lediglich ein »
Aussterben« gewesen, das überdies einer karmischen Gesetzmäßigkeit folgte und somit als Bestandteil einer weisheitsvollen Vorsehung akzeptiert werden müsse. Die karmische Unausweichlichkeit des »
Aussterbens« der Indianer ergebe sich ja gerade daraus, dass die indianische »
Rasse« als absterbender Zweig des Menschheitsbaumes ohnehin dem Untergang geweiht sei. Die Rede vom »
Aussterben« der amerikanischen Urbevölkerung ist und bleibt in diesem Zusammenhang ein Euphemismus, dessen Wirkung auf zeitgenössische Leser und Zuhörer die Autoren Bader und Ravagli vergeblich zu entkräften suchen. Darüber hinaus zeigt dieses Beispiel auf beklemmende Weise, dass der Verknüpfung des Schicksalsgedankens mit dem theosophischen Modell der einander ablösenden Völker- und Kultur- »Missionen« stets die Gefahr einer Relativierung von Genoziden und ähnlichen Verbrechen innewohnt. Denn auch wenn – so ließe sich Steiners Gedankenfaden aufnehmen – die Kolonisatoren aus niederen Motiven ihre Mordtaten verrichteten und so- mit schwere Schuld auf sich luden: Waren sie nicht dennoch Werkzeuge einer göttlichen Vorsehung, die den kulturellen und physischen Untergang der Indianer bereits lange vorher beschlossen hatte? – Eine kritische Aufarbeitung des oft schillernden Karmaverständnisses damaliger Theosophen könnte den Nachweis erbringen, dass die Möglichkeit einer verkürzten Interpretation dieses Gedankens unter Zuhörern sowie Lesern des »Volksseelen«-Zyklus real gegeben war. (13)
Anthroposophie und Antijudaismus I: Rudolf Steiner über den Ahasver-Mythos
In dem Gesamtwerk Steiners finden sich einige Äußerungen des Vortragenden zum Thema »Rassen«, die beim heutigen Leser für erhebliche Irritationen sorgen, die absolut »unverdaulich« erscheinen, deren Brisanz sich meinem Dafürhalten nach auch nicht – wie es das Bestreben der Autoren Bader, Leist und Ravagli ist – durch inhaltliche oder historische Kontextualisierungs- Bemühungen weg disputieren lässt.
Als Beispiel sei im Folgenden Rudolf Steiners Ausdeutung der mittelalterlichen Legende vom »ewigen Juden« Ahasver genannt. Die Quintessenz der in Rede stehenden Passage, welche in einem Vortrag des 1908 vor Berliner Publikum gehaltenen Zyklus’ »
Das Hereinwirken geistiger Wesen in den Menschen« enthalten ist (14), lässt sich folgendermaßen wiedergeben: Demnach verkörpern sich »
höher entwickelte« Seelen in »
höheren Rassen«, während weniger »
vollkommene« Seelen sich in »
untergehenden« bzw. »
dekadenten Rassen« inkarnieren würden. Diese Gesetzmäßigkeit gelte auch für die gegenwärtigen Verhältnisse. Steiner lässt seine Zuhörer darüber im Unklaren, welche Definitionen er den Begriffen »
höhere Rasse«, »
Dekadenz« oder »
Vollkommenheit« zugrunde legt. Für das sich vornehmlich aus Angehörigen europäischer Bildungsschichten rekrutierende Auditorium, das sich wohl einiges auf die Errungenschaften seiner christlich-abendländischen Kultur zugute hielt, wird sich die Frage nach der Bedeutung solcher Begriffe vermutlich gar nicht erst gestellt haben. Waren doch Ausdrücke wie »Dekadenz«, »höhere Rasse« oder »Vollkommenheit« Bestandteil eines kulturellen Codes des selbstbewussten europäischen Bildungsbürgertums im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert, dessen semantischer Gehalt stillschweigend vorausgesetzt werden konnte, der folglich nicht eigens aufgeschlüsselt oder »übersetzt« werden musste.
Um seine Deutung von »höheren« und »niederen Rassen« bildhaft zu untermauern, bemüht Steiner die Legende von Ahasver, den im Hochmittelalter entstandenen Mythos vom »ewigen Juden«. Ahasver, der in später entstandenen Holzstichen und Lithographien der Volksliteratur oft als gebeugter Greis mit wehendem Rauschebart dargestellt wird, ist aufgrund seiner Abweisung des zum Kreuzestod bestimmten Heilands dazu verurteilt, in ruheloser Vagabundage umherzuziehen – solange, bis ihn eines Tages die Erlösung finden werde. Steiner interpretiert nun diese Legende dahingehend, dass Seelen, welche den Christus-Impuls in verschiedenen, aufeinander folgenden Inkarnationen von sich gewiesen hätten, dazu verurteilt seien, in einer »
dekadenten, untergehenden Rasse« zu verbleiben, mit dieser gar zu »
verwachsen«: »
Das ist die tiefere Idee des ›Ahasver‹, der immer in derselben Gestalt wiederkommen muss, weil er die Hand des größten Führers, des Christus, von sich gewiesen hat. So ist die Möglichkeit für den Menschen vorhanden, mit dem Wesen einer Inkarnation zu verwachsen, den Menschheitsführer von sich zu stoßen, oder aber die Wandlung durchzumachen zu höheren Rassen, zu immer höherer Vervollkommnung. Rassen würden gar nicht dekadent werden, gar nicht untergehen, wenn es nicht Seelen gäbe, die nicht weiterrücken können und nicht weiterrücken wollen zu einer höheren Rassenform.« (15) Zwar nimmt der Vortragende die Konnotation von »untergehender, dekadenter Rasse« und Judentum nicht explizit vor, doch liegt auf der Hand, dass der Rekurs auf die mittelalterliche Ahasver-Sage bei den christlich sozialisierten Zuhörern eben jene Assoziation hervorrief, die sich auf eine Jahrtausende alte Tradition der Verunglimpfung des Judentums als dem Untergang geweihter Religion des Alten Bundes stützten konnte. Steiner ist in diesem Fall auch Kind seines in naturwissenschaftlichen Begriffen denkenden Zeitalters, wenn er die mythische Trias Ahasver-Christusleugner-ewiger Jude um die Ingredienz »Rasse« bereichert, der er in Fortschreibung des traditionellen antijudaistischen Ressentiments eine »Minderwertigkeit« attestiert, die nun nicht mehr ausschließlich durch religiöse, sondern durch biologische Metaphern wie »
dekadente Rasse« und »
Untergang« charakterisiert wird. (16)
Die Autoren Ravagli, Bader und Leist taten gut daran, als sie in ihrer Studie zum Antisemitismus-Vorwurf diese Stelle im Vortragswerk Rudolf Steiners schlichtweg ignorierten. Denn der fragliche Passus hätte sich schwerlich in einem argumentatorischen Kontext unterbringen lassen, welcher dem Versuch gewidmet ist, den Begründer der Anthroposophie von dem Vorwurf antijudaistischer und rassistischer Vorurteile freizusprechen.
Man mag es drehen und wenden wie man will: Die Botschaft der von Steiner angebotenen, »modernen« Interpretation der mittelalterlichen Ahasver-Legende bleibt für den heutigen Leser unerträglich: gerade aufgrund ihrer schillernden, zu allerlei Assoziationen einladenden
Semantik, der Unbedarftheit, mit welcher der Redner seine Deutungen vorträgt, ihres an traditionell judenfeindliche Denkfiguren und Topoi anschließenden Subkontextes, wie ihn damals jeder mit der Muttermilch aufgesogen und internalisiert hatte, der dem christlichen Abendland zugehörte. Unerfindlich bleibt, warum der Vortragende, der sich an anderer Stelle scharf gegen die Propaganda politischer Antisemiten aussprach und sich wiederholt vom antisemitischen Diskurs damaliger Zeit distanzierte (17), hier nicht den Versuch unternimmt, die gefahrvollen antijudaistischen Stereotypen und Bilder seiner Zeit aufzulösen oder zumindest deutlich zu machen, welche Folgerungen sich nicht aus ihrer Rezeption ab- leiten lassen.
Anthroposophie und Antijudaismus II
Friedrich Rittelmeyers »Deutschtum« anno 1934
Dass Steiners offenbar beträchtliche Vertrauensinvestition in das Urteils- und Unterscheidungsvermögen seiner Anhänger keinesfalls immer gerechtfertigt gewesen sein dürfte, zeigen nicht zuletzt Beispiele des Missbrauchs anthroposophischer Inhalte in der Zeit des Dritten Reichs. So inkriminierte etwa Friedrich Rittelmeyer in seinem 1934 erschienenen Buch »
Deutschtum« die »
Überlebtheit« der jüdischen Religion, deren geschichtliche Bedeutung er auf eine Vorbereiter- und Hebammenfunktion für das »
Mysterium von Golgatha« reduzierte – und das, obwohl sich die jüdische Weltreligion erst in den Jahrhunderten nach Christi Geburt allmählich zu formieren begann und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Buches bereits auf eine zweitausendjährige geistige und kulturelle Blüte zurückblicken konnte. Bezeichnenderweise verwendet Rittelmeyer die Begriffe »Religion« und »Rasse« zum Teil synonym. In den Juden seiner Zeit kann der Autor des »Deutschtum« nicht viel mehr als die Multiplikatoren eines »
zersetzenden Ungeistes« erblicken, der sich in den vier negativen Phänomenen »
Intellektualismus«, »
Materialismus«, »
Kapitalismus« und »
Egoismus« widerspiegele.
Zwar seien diese pejorativen Eigenschaften der Möglichkeit nach in allen Menschen veranlagt, doch verkörpere sie »
der Jude« (Rittelmeyer bevorzugt die Verallgemeinerungen und Abstraktionen zugänglichere Singularform) in geradezu idealtypischer Weise. (18) »
Der Jude« wird somit zum »
Symbol der Zeit« (Theodor Barth), der gesellschaftlichen Missstände schlechthin stilisiert und auf diese Weise depersonalisiert – eine Vorgehensweise, wie sie in der antisemitischen Propaganda Legion ist. Man rufe sich das Datum des Erscheinens dieser Schrift in Erinnerung, um die politische Tragweite einer solchen Aussage zu ermessen: Nach dem Boykott jüdischer Geschäfte, der Entlassung »nichtarischer« Beamter und Anwälte, der Einführung eines Numerus Clausus für Juden an Schulen und Universitäten, den ersten antisemitisch motivierten Verhaftungswellen und Gewalttaten konnte das von Rittelmeyer in erster Linie theologisch gemeinte Verdikt nicht anders als ein politisches Urteil, als Duldung, wenn nicht gar als Rechtfertigung der nationalsozialistischen Maßnahmen gelesen werden.
Heutige, der Anthroposophie nahestehende Interpreten sehen bisweilen in dem religiös motivierten Antijduaismus des Theologen Rittelmeyer eine Art Gegengewicht zum »problematischeren« (Rassen-) Antisemitismus der Nationalsozialisten. Gerhard Wehr etwa liest Rittelmeyers »Deutschtum« als eine Verteidigungsschrift des kosmopolitischen Christentums gegenüber dem völkisch verengten Religionsbegriff der NS-hörigen »Deutschen Christen«. (19) Die Propagandisten der DC verlangten eine Entfernung jüdisch-stämmiger Christen aus der Kirche und eine »
Wiedereinsetzung« des Christentums als »
arteigener Religion«. Tatsächlich finden sich in Rittelmeyers Schrift Äußerungen, aus denen ersichtlich wird, dass es dem Autor vorrangig um eine Entgegnung auf den Rassismus und Nationalismus der neuen Machthaber ging. Diese Entgegnung bleibt jedoch in entscheidenen Punkten fragwürdig, da sich Rittelmeyers Argumente – was Wehr in seiner Biografie unterschlägt – im klassischen Begründungsrahmen der kirchlich- antijudaistischen Traditionen bewegen. Wehr rechnet es Rittelmeyer hoch an, dass dieser zu einem Zeitpunkt der politischen Gefährdung der Christengemeinschaft und ihrer Pfarrer klärende Worte zur Blut-und- Boden-Ideologie und somit indirekt auch zum Antisemitismus des NS-Regimes gefunden habe: »
Auch wenn Rittelmeyer hier und an anderen Stellen seines Schrifttums immer wieder auf Wesen und Mission der Deutschen zu sprechen kommt, so geschieht es so, dass das rassisch oder volkstümlich Typische stets dem Allgemein-Menschlichen untergeordnet ist. So geht es ihm letztlich nur um einen sehr eingeschränkten, vorläufigen Sinn um ›Deutschtum‹. Es geht ihm um Menschentum, um die volle Menschwerdung des Menschen, um einen Prozess, der jeweils dort anzusetzen hat, wo sich ein Volk, eine Gesellschaft gerade befindet.« (20) Viel mehr, so versucht Wehr in seiner Deutung den Eindruck zu erwecken, hätte auch ein Rittelmeyer zu diesem Zeitpunkt nicht zu sagen vermocht. Ein solches als Wertschätzung gemeintes Urteil mutet allerdings wenig plausibel an, da Rittelmeyer ja nicht gezwungen war, überhaupt etwas über die Juden zu diesem Zeitpunkt zu sagen. In den ersten Monaten ihres Bestehens war die nationalsozialistische Diktatur noch keineswegs flächendeckend konsolidiert und ließ in publizistischen Bereichen diverse Freiräume für die Äußerung von Zwischentönen, ja von moderater Kritik zu. Solche Residuen wurden denn auch vielfach von Regimegegnern sowie von protestantischen und katholischen Kritikern der »Deutschen Christen« genutzt. Zu jenen, welche die sich hier auftuenden Freiräume vorsichtig nutzten, zählte auch Friedrich Rittelmeyer.
Die antijüdische Argumentation seiner Schrift »Deutschtum« stützte sich nicht auf einen völkischen Rassismus, sondern auf den traditionellen Antijudaismus der christlichen Konfessionen, von dem sich Rittelmeyer als Apostat der evangelischen Kirche offenbar zeit seines Lebens nicht loszusagen vermochte. Seine Einschätzung des zeitgenössischen Judentums mag überdies durch eine selektive Ausbeute von Äußerungen Rudolf Steiners motiviert gewesen sein, dessen Sichtweisen auf das Diaspora- Judentum nicht ausschließlich ablehnend waren, sondern Zwischentöne zuließ. Rittelmeyers Gleichsetzung von »
Rasse« und jüdischer Kultur, deren Repräsentanten bis auf Ausnahmen wie den »
Logiker Husserl« oder seinen »
Rassegenossen Spinoza« kulturell nichts Zukunftsweisendes mehr zustande brächten, näherte sich den antisemitischen Argumentationsmustern der Machthaber bedenklich an, die mit eben solcher Propaganda ihrer Politik der Verfolgung und Entrechtung der jüdischen Minderheit den Boden zu bereiten suchten.
Wie gehen Anthroposophen mit dieser antijudaistischen Tradition um?
Die Haltung Friedrich Rittelmeyers zur jüdischen Kultur und Religion seiner Zeit – in dem wenige Monate nach Hitlers Machtübernahme erschienenen Buch »Deutschtum« für die Nachwelt dokumentiert – offenbart ein Problem, das bis heute unter »anthroposophisch Korrekten« weitgehend tabuisiert ist und das von den Autoren der Studien »Rassenideale« nicht einmal ansatzweise in den Blick genommen wird: Wie gehen Anthroposophen mit den Erb- und Folgelasten einer überwiegend religiös motivierten Judenfeindschaft um?
Nachdem evangelische und katholische Theologen bereits seit Jahrzehnten mit der Aufarbeitung der antijudaistischen Geschichte der Großkirchen beschäftigt sind und an einer Rehabilitierung der Vaterreligion durch die Sohnesreligion arbeiten, ergeht die Frage an uns, wie lange wir noch an den Zeugnissen unserer eigenen Vergangenheit vorübergehen wollen, wie lange wir noch so tun wollen, als sei diese Vergangenheit längst abgeschlossen und als werfe sie nicht fortwährend ihre Schatten auch in die Gegenwart hinein. (21)
Nachzugehen wäre Fragen wie diesen: Inwieweit stehen heutige anthroposophische Sichtweisen des Judentums noch in der antijudaistischen Tradition der vergangenen Jahrhunderte? Welche Bemühungen haben Angehörige der Anthroposophischen Gesellschaft und der Christengemeinschaft bislang unternommen, um sich der historischen Abhängigkeit ihrer eigenen Anschauungen und Deutungen bewusst zu werden? Haben jüdisch- stämmige Mitglieder anthroposophischer Einrichtungen mit antijudaistischen Bekenntnissen in den eigenen Reihen Erfahrungen gesammelt und wenn ja: inwiefern und in welchem Umfang? Unter »kritischer Geschichtsaufarbeitung« verstehe ich nicht zweifelhafte Vorhaben einer »Symptomatologie« deutsch-jüdischer Geschichte oder gar einer »esoterischen Wesensbestimmung« des Nationalsozialismus (die dann doch nur Funktionen der moralischen Selbstentlastung wahrzunehmen hätten), sondern eine nüchterne, an den historischen Quellen orientierte Rekonstruktion des Gewesenen. Einen Schritt in diese Richtung stellt die 1999 erschienene Studie »
Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus« dar, deren Verfasser jedoch die Frage, inwieweit antijudaistische oder antisemitische Anschauungen unter damaligen Anthroposophen verbreitet waren, vollständig ausklammert. (22)
In den letzten Jahren haben einige Autoren anthroposophischer Zeitschriften den Versuch unternommen, sich mit der in eigenen Reihen fortwirkenden antijudaistischen Überlieferungstradition kritisch auseinanderzusetzen. (23) Die Ausgangsprämissen solcher Bemühungen sind jedoch nicht immer unproblematisch: Denn die Versuchung ist gerade unter christlich-esoterischen Interpreten groß, aus einem oberflächlichen, dem schlechten Gewissen zuzuschreibenden Philosemitismus heraus in die mannigfaltigen, zum Teil noch heute bestehenden Traditionsbestände jüdischer Spiritualität das verborgene Wirken eines »Christus-Impulses« hineinzuprojizieren, um auf diese Weise die jüdische Religion dem eigenen Empfinden oder Urteil schmackhafter zu machen. Natürlich ist es legitim (und zahlreiche Hinweise Rudolf Steiners legen dies auch nahe), sich das Wirken des Christus-Wesens als überkonfessionell vorzustellen und infolgedessen auch in so genannten nichtchristlichen Religionen nach Spuren der Christus-Wirksamkeit zu fahnden. Zunächst kann es meiner Ansicht nach jedoch nur darum gehen, das Fremdartige und vielleicht auch Anstößige eines anderen Gedankenkosmos möglichst unbefangen auf sich wirken zu lassen. In einem weiteren Schritt könnte der Versuch unternommen werden, diesen weltanschaulichen Kosmos auch immanent, d.h. aus sich selber heraus zu erschließen. Ein »Verstehen« wird freilich immer nur bis zu einem gewissen Grade möglich sein, da wir unsere kulturelle Identität, unsere begrifflichen Voreingenommenheiten, unsere gesellschaftlichen Prägungen und persönlichen Dispositionen nicht einfach abstreifen können wie ein Kleid, das zu eng oder zu alt geworden ist. Unser hermeneutisches Bemühen liefe jedoch ins Leere, wenn wir den Ideenkosmos der Angehörigen fremder Religionen ausschließlich oder auch nur vorrangig mit dem Inventar der eigenen Vorstellungs- und Erfahrungswelt auszustaffieren suchten. Durch eine vorschnelle Harmonisierung unterschiedlicher religiöser Anschauungen – wofür es in der Geschichte der nach dem »gemeinsamen Wesenskern« der Weltreligionen suchen- den Theosophen und Anthroposophen einige Beispiele gibt – erweist man aber weder dem Judentum noch dem esoterischen Christentum einen wirklichen Dienst.
Unzeitgemäße Wagenburg-Mentalität der anthroposophischen Autoren Bader, Leist und Ravagli und des Bundes der Waldorfschulen
Im Subkontext transportierten Rudolf Steiners Forderungen nach völliger Assimilation der jüdischen Minderheit sowie seine oft stereotypen Miniaturen jüdischen Daseins Elemente eines «antisemitischen Codes» rechtsbürgerlicher sowie linksliberaler Kreise in den Jahrzehnten vor und nach dem Ersten Weltkrieg. Als manifesten (Rassen-) Antisemiten könnte man ihn freilich nur dann apostrophieren, wenn sich herausstellte, dass seine wiederholten Distanzierungen vom judenfeindlichen, nationalistischen und rassistischen Diskurs damaliger Zeit nicht ernst gemeint waren und somit lediglich als Vorwand dienten, um unter der Hand eine politische Agitation zu betreiben, die auf eine gesellschaftliche Ausgrenzung bzw. Benachteiligung von Juden abzielte. Eine solche Deutung erscheint jedoch angesichts der Fülle an gegenteiligen Belegen und Zeugnissen als wenig überzeugend.
Ob Steiner als ein Angehöriger des 19. und frühen 20. Jahrhunderts jedoch »
rassistische und diskriminierende Auffassungen völlig fremd« waren, wie der Klappentext des zweiten Bandes der vom Bund der Waldorfschulen herausgegebenen Studien versichert, hängt nicht zuletzt auch davon ab, welcher Lesart des Begriffes »Rassismus« man den Vorzug gibt. (24) Warum, so habe ich mich immer wieder bei der Lektüre dieser Schriften gefragt, können die Autoren nicht einfach zugeben, dass einzelne Äußerungen Steiners, die etwa Rassen nichteuropäischer Herkunft als »
verholzt«, »
absterbend« oder »
dekadent« ausweisen, aus heutiger Sicht als rassistisch zu bewerten sind? Als Vortragsredner und Autor rezipierte Steiner Elemente des rassentheoretischen und eben auch rassistischen Diskurses damaliger Zeit durchaus positiv, wenngleich dieses nicht ohne den ernsthaften Versuch geschah, über Engführungen desselben hinauszuweisen und damit zugleich den Keim zur Überwindung dieses Diskurses zu legen. Den von Helena P. Blavatsky in erster Linie zu Periodisierungs- Zwecken verwendeten Begriff »Wurzelrasse« ersetze er allmählich durch semantisch zutreffendere Ausdrücke wie »
Epoche«, »
Hauptzeitraum« oder »
Zeitalter«. Blavatskys »
Unterrassen«, welche die »
Wurzelrassen« untergliedern sollten, nannte Steiner nach 1907 zunehmend und dann ausschließlich »
Kulturepochen«, »
Kulturperioden« oder »
Kulturzeitalter«, worin ein Versuch gelesen werden kann, rassentheoretische Konnotationen vollständig in den Hintergrund treten zu lassen. (25)
Die Ausdifferenzierung der Menschheit in biologische »Rassen«, so die Überzeugung Steiners, sei ohnedies nur eine vorübergehende Erscheinung der Geschichte. Sie werde in Zukunft an Bedeutung verlieren und eines Tages völlig überwunden sein. Es werde dahin kommen, so prognostizierte er bereits 1907, »
dass alle Rassen- und Stammeszusammenhänge wirklich aufhören. Der Mensch wird vom Menschen immer verschiedener werden. Die Zusammengehörigkeit wird nicht mehr durch das gemeinsame Blut vorhanden sein, sondern durch das, was Seele an Seele bindet. Das ist der Gang der Menschheitsentwicklung«. (26)
»
Ein Mensch«, so urteilte Steiner 1917 im Hinblick auf die Ursachen des Ersten Weltkrieges, »
der heute von dem Ideal der Rassen und Nationen und Stammeszugehörigkeiten spricht, der spricht von Niedergangsimpulsen der Menschheit. Und wenn er in diesen so genannten Idealen glaubt, fortschrittliche Ideale vor die Menschheit hinzustellen, so ist das die Unwahrheit. Denn durch nichts wird sich die Menschheit mehr in den Niedergang hinein bringen, als wenn sich die Rassen-, Volks- und Blutsideale fortpflanzen.« (27) Stattdessen sei es notwendig, dass die anthroposophische Bewegung »
... gerade im Grundcharakter dieses Abstreifen des Rassencharakters aufnimmt, dass sie nämlich zu vereinigen sucht Menschen aus allen Rassen, aus allen Nationen, und auf diese Weise überbrückt diese Differenzierung, diese Unterschiede, diese Abgründe, die zwischen den einzelnen Menschengruppen vorhanden sind.« (28)
Reichlich Material für eine Auseinandersetzung mit dem Zeitbedingten im Werk Rudolf Steiners bietet ein Beitrag des katholischen Theologen und Politologen Helmut Zander über »
Anthroposophische Rassentheorie«, der auch Beispiele selektiver Ausbeute von Aussagen Steiners und deren Instrumentalisierung für rassenpolitische Zwecke dokumentiert. (29) Trotz Irrtümern und Verzerrungen, welche die Darstellung Zanders mancherorts auszeichnet, ist es diesem gelungen, die problematischen Implikationen, welche das von Steiner entworfene Geschichtsmodell einander ablösender Völker-»Missionen«, Kulturen oder Religionen bereit hält, freizulegen. Warum es Anthroposophen bisweilen schwer fällt, bestimmte Aussagen ihres Lehrers kritisch zu hinterfragen oder sich von diesen zu distanzieren, hängt Zander zufolge damit zusammen, dass dieser von seinen Anhängern weniger als Begründer einer Wissenschaft denn als Religionsstifter behandelt würde; ein Beobachtung, die nicht unbedingt neu ist, der jedoch in dem Zusammenhang mit dem Rassismus-Vorwurf eine Brisanz ganz eigener Art zukommt. Zanders Bemühen, die Anthroposophie unter die neureligiösen Weltanschauungen zu subsumieren, folgt einer inneren Konsequenz, sofern man bereit ist, nicht die theoretischen Ansprüche von Anthroposophen, sondern die vielfache Praxis des Umganges mit Aussagen Steiners zum Maßstab der Beurteilung zu erheben. Charakteristisch für Religionsgemeinschaften ist es ja gerade, dass deren Mitglieder weniger von Forschungs- als vielmehr von Glaubensinteressen und -bedürfnissen geleitet werden. Kritik wird in anthroposophischen Kreisen auch heute noch vielfach nicht als Chance zur Erweiterung des Erkenntnishorizontes begriffen, sondern als eine Gefährdung binnensozialer Plausibilitäts- und bisweilen auch Machtstrukturen wahrgenommen. Oder mit Worten Helmut Zanders ausgedrückt: »
Das entscheidene Problem scheint mir die Furcht von Anthroposophen vor einem legitimationsgefährdenden Domino-Effekt zu sein: Wenn ein Teil von Steiners Weltanschauung fällt, weiß niemand, was am Ende noch stehen bleibt.« (30)
Zanders Versuch einer kritischen Darstellung anthroposophischer Rassentheorien wird von den Verfassern der beiden Studien nicht einmal ansatzweise gewürdigt, sondern stattdessen der »gegnerischen Literatur« zugerechnet – und somit keiner weiteren Beschäftigung für würdig erachtet. Dabei wäre gerade der Artikel Zanders eine Gelegenheit gewesen, über den heutigen Umgang mit Steiners Rassenklassifikationen und über die oft problematische Geschichte ihrer Rezeption nachzudenken und dieser Reflexion nach außen hin sichtbare Konsequenzen folgen zu lassen. Man muss sich nicht von der Anthroposophie oder ihrem Begründer distanzieren, wie manche »linke« Autoren in einem Akt vorauseilenden Gehorsams gegenüber der »Political Correctness« verlangen, wenn man öffentlich einräumt, dass nicht alles, was Steiner in nahezu drei Jahrzehnten emsiger Vortragstätigkeit und unausgesetzter literarischer Schaffensfreude der Nachwelt übergeben hat, für bare Münze zu nehmen ist. Protestanten haben Vergleichbares in Bezug auf den Antijudaismus des späten Martin Luther geleistet, undogmatische Linke in Hinsicht auf antisemitische und rassistische Ansichten von Karl Marx und Friedrich Engels – und selbst ausgesprochene Bewunderer der Philosophie Immanuel Kants räumen mittlerweile ein, dass jener Repräsentant der Aufklärung, der eine Ethik der Menschenrechte formulierte, den »
Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit« forderte und eine Monogenese menschlicher Rassen vertrat, andernorts weniger aufgeklärt räsonierte, sondern rassistischen und antijudaistischen Ressentiments anhing. (31)
Leist, Bader und Ravagli geht es jedoch nicht um eine ernsthafte, geschweige denn wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Einwänden von Anthroposophie-Kritikern, sondern ausschließlich um Verteidigung und Abwehr. Diese Wagenburg-Strategie mag nachvollziehbar erscheinen angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, mutet aber in jedem Fall anachronistisch an. Es könnte zudem sein, dass der Funken dieser Mentalität von den Schriften auf einige anthroposophische Leser überspringt. Wenn jedoch erst einmal das Gewissen beruhigt und das durch die Rassismus-Vorwürfe angeschlagene Selbstbewusst- sein wiederhergestellt ist, lässt es sich dann nicht umso bedenkenloser zu den unkritischen Rezeptions- Gewohnheiten der Vergangenheit zurückkehren? Die Debatte um rassistische Inhalte anthroposophischer Anschauungen und deren Tradierung durch heutige Interpreten erschiene von dieser Warte aus betrachtet nicht viel mehr als eine Verschwörung, die Gegner der Anthroposophie böswillig ins Werk setzten, um deren Vertreter von ihren eigentlichen spirituellen Aufgabenstellungen abzubringen. Das apologetische Unternehmen der Autoren Bader, Leist und Ravagli könnte sich somit auf lange Sicht hin noch als Bumerang erweisen.
____________________
Zum Autor:
Ralf Sonnenberg, geb. 1968, lebt als Historiker und Religionswissenschaftler in Berlin. Zwischen 2001 und 2007 war er Redakteur der anthroposophischen Zeitschrift »Die Drei«. Er ist u.a. Autor der Studie »Keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens«. Judentum, Zionismus und Antisemitismus aus der Sicht Rudolf Steiners, erschienen in: Wolfgang Benz (Hg.): «Jahrbuch für Antisemitismusforschung» 12 (2003), Berlin 2003, S. 185-209 sowie Herausgeber des Sammelbandes Anthroposophie und Judentum. Perspektiven einer Beziehung, Frankfurt a.M. 2009.
Anmerkungen:
1 Hans-Jürgen Bader/ Manfred Leist/ Lorenzo Ravagli: Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit. Anthroposophie und der Antisemitismusvorwurf, Stuttgart 2002 sowie Hans-Jürgen Bader/ Lorenzo Ravagli: Rassenideale sind der Niedergang der Menschheit. Anthroposophie und der Rassismusvorwurf, Stuttgart 2002.
2 Rudolf Steiner: Die Mission der einzelnen Volksseelen im Zusammenhang mit der germanisch-nordischen Mythologie (GA 121), Dornach 1983, S. 78.
3 Immanuel Kant: Der Streit der Fakultäten. 1. Abschnitt, Allg. Anmerkung. Band 7, Berlin 1907, S. 53.
4 Vgl. hierzu ausführlich Ralf Sonnenberg: »Keine Berechtigung innerhalb des modernen Völkerlebens«. Judentum, Zionismus und Antisemitismus aus der Sicht Rudolf Steiners, erschienen in: Wolfgang Benz (Hg.): «Jahrbuch für Antisemitismusforschung» 12 (2003), S. 185-210. Eine aktualisierte und vollständig überarbeitete Fassung des Artikels siehe www.hagalil.com/antisemitismus/deutschland/steiner.htm.
5 Zur gegenwärtigen Kontroverse um antisemitische Positionen in den Werken herausragender Vertreter der Aufklärung, der Romantik und des philosophischen Idealismus vgl. folgende Literaturauswahl: Hans-Joachim Becker: Fichtes Idee der Nation und das Judentum, Amsterdam 2000; Micha Brumlik: Deutscher Geist und Judenhass. Das Verhältnis des philosophischen Idealismus zum Judentum, München 2000; Horst Gronke/ Thomas Meyer/ Barbara Neißer (Hg.): Antisemitismus bei Kant und anderen Denkern der Aufklärung, Würzburg 2001; Gudrun Hentges: Schattenseiten der Aufklärung, Schwalbach/Ts. 1999.
6 So eine antijudaistische Formulierung Steiners in einer 1888 erschienenen Rezension eines Werkes des österreichischen Dichters Robert Hamerling. Zu diesem Komplex ausführlich www.hagalil.com/antisemitismus/deutschland/steiner-2.htm.
7 Ahnherren anthroposophischer Rassenlehren waren neben Helena Petrowna Blavatsky (1831-1891) und Ernst Haeckel (1834-1919) vermutlich auch Johann Friedrich Blumenbach (1752-1840) und Carl Gustav Carus (1789-1869). Vom letzteren stammte die auch von Rudolf Steiner in variierter Form gebrauchte Einteilung der Menschheit in »Tagvölker« (Europäer), »Nachtvölker« (Äthiopier) und »Dämmerungsvölker« (Asiaten und Indianer). Vgl. hierzu Klaus Endres/ Wolfgang Schad: Die Vielfalt der Menschen, in: »Sonderheft der Mitteilungen aus der anthroposophischen Arbeit in Deutschland«, Sommer 1995, S. 36-70.
8 Rudolf Steiner: Die Stufen der höheren Erkenntnis (GA 12), Dornach 1986, S. 11.
9 Rudolf Steiner: Die Philosophie der Freiheit. Seelische Beobachtungsresultate nach naturwissenschaftlicher Methode, Dornach 1986, S. 256.
10 Siehe den Untertitel von Steiners Philosophie der Freiheit, in dem die Methode der seelischen Beobachtung programmatisch angekündigt wird. Vergl. auch ders.: Theosophie. Einführung in übersinnliche Welterkenntnis und Menschenbestimmung (GA 9), Dornach 1990, S. 65.
11 Steiner: Die Mission der einzelnen Volksseelen, S. 29.
12 Bader/ Ravagli: Rassismusvorwurf, S. 73 f.
13 Im Wortlaut auffallend ähnliche, kaum minder missverständliche Aussagen über eine »karmische Notwendigkeit« des »Verlöschens« der »greisenhaften Stämme« Amerikas, über welche die »Flutwelle der inkarnierten Egos« hinweg rolle, finden sich bei H.P. Blavatsky, deren Hauptwerke Steiner intensiv studiert haben dürfte. Vgl. H.P.Blavatsky: Die Geheimlehre, Bd. 2, S. 824 f.
14 Rudolf Steiner: Das Hereinwirken geistiger Wesenheiten in den Menschen (GA 102), 10. Vortrag, Berlin, 16.5. 1908, Stuttgart 2001.
15 Ebenda , S. 174.
16 Die vermeintliche physische Minderwertigkeit und Dekadenz der jüdischen »Rasse« war Gegenstand eines Diskurses um 1900, der gesellschafts- und fraktionsübergreifend verlief. Siehe Klaus Hödl: Die Pathologisierung des jüdischen Körpers. Antisemitismus, Geschlecht und Medizin im Fin de Siecle, Wien 1997.
17 Vgl. www.hagalil.com/antisemitismus/deutschland/steiner-4.htm.
18 Friedrich Rittelmeyer: Deutschtum, Stuttgart 1934. Kapitel: Juden und Deutsche. Der Niedergang des Judentums.
19 Gerhard Wehr: Friedrich Rittelmeyer: Sein Leben – Religiöse Erneuerung als Brückenschlag, Stuttgart 1998.
20 Wehr: Rittelmeyer, S. 235.
21 Dazu Ralf Sonnenberg: Holocaust-Leugnung und der Umgang mit der deutschen Geschichte, in: Lorenzo Ravagli (Hg.): »Jahrbuch für anthroposophische Kritik 1999«, München 1999, S. 158-185.
22 Uwe Werner: Anthroposophen in der Zeit des Nationalsozialismus, München 1999. Dem von Werner gemiedenen Fragekomplex ist stattdessen umso eifriger der Politologe Peter Bierl nachgegangen, der das einschlägige Quellenmaterial überaus selektiv aufbereitet und mit stark polemischer Einfärbung präsentiert: Peter Bierl: Wurzelrassen, Erzengel und Volksgeister. Die Anthroposophie Rudolf Steiners und die Waldorfpädago-gik, Hamburg 1999.
23 Vgl. zum Beispiel Samuel Ichmann: Was Gott ist – oder auch nicht. Aufzeichnungen eines jüdischen Waldorflehrers, in: »Info3«, Nr. 6/2000, S. 25-29 oder Andreas Heertsch/ Benedikt Marzahn/Rainer Marks: Antisemitismus im Oberruferer Dreikönigsspiel?, »Mitteilungen aus dem anthroposophischen Leben in der Schweiz«, Nr. 10, Oktober 2002, S. 1-4.
24 Zur wissenschaftlich nicht immer eindeutigen Semantik des Rassismus-Begriffs, der schnell als politischer Kampfbegriff missbraucht werden kann, siehe etwa Helmut Zander: Anthroposophie in Deutschland, 2 Bde., Göttingen 2007, hier Band 1: S. 631 ff. Eine zum Teil fundierte Kritik mancher Deutungen Zanders bietet die Studie Zanders Erzählungen. Eine kritische Analyse des Werkes «Anthroposophie in Deutschland» (Berlin 2009) von Lorenzo Ravagli.
25 Die Begriffe «Arier» und «arische Wurzelrasse» gebrauchte Steiner ohnedies äußerst selten. Auf den über 89000 Seiten in über 300 Bänden der Rudolf-Steiner-Gesamtausgabe kommt der Terminus «arische Wurzelrasse» auf genau zehn Seiten vor. Zur semantischen Aufschlüsselung der in der Anthroposophie gebräuchlichen Periodisierungen «Wurzelrasse», «Unterrasse» oder «Kulturepoche» siehe Bader/ Ravagli: Rassismus- Vorwurf.
26 Rudolf Steiner: Die Theosophie des Rosenkreuzers, Dornach 1986, S. 129.
27 Rudolf Steiner: Die spirituellen Hintergründe der äußeren Welt. Der Sturz der Geister der Finsternis, Dornach 1998, S. 205.
28 Rudolf Steiner: Die tieferen Geheimnisse des Menschheitswerdens im Lichte der Evangelien, Dornach 1986, S. 152.
29 Helmut Zander: Anthroposophische Rassentheorie. Der Geist auf dem Weg durch die Rassengeschichte, in: Stefanie von Schnurbein / Justus H. Ulbricht (Hg.): Völkische Religion und Krisen der Moderne, Würzburg 2001, S. 291-341.
30 Ebenda, S. 340.
31 Siehe etwa Meyer/ Neißer: Antisemitismus bei Kant.